Gewinner des 8. ALFILM Festivals Berlin
Das 8. arabische ALFILM Festival gab seinen Publikumsfavoriten bekannt.
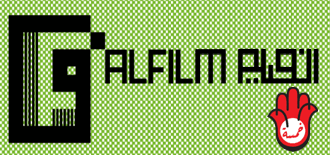
Am 7.4.2017 ging das 8. Arabische Filmfestival Berlin mit einer ausverkauften Vorstellung des Klassikers "The Night of Counting the Years (Al Mummia)" zu Ende, der im Rahmen der Retrospektive zu Shadi Adel Salam gezeigt worden war. Wir hatten das Festival ausführlich am 30. März 2017 bei uns im BAF-Blog vorgestellt und speziell auf diesen Film hingewiesen. Für Nachzügler ist das 1969 gedrehte Meisterwerk weiterhin auf YouTube in voller Länge einzusehen.
Noch vor der letzten Vorstellung wurde der Publikumsfavorit bekannt gegeben - der Film, der den Besuchern des Festivals in diesem Jahr am besten gefallen hat.
Es ist "Ghost Hunting" von Raed Andoni, der von den Protagonisten Mohammad Khattab und Ramzi Maqdisi dem Berliner Publikum persönlich vorgestellt wurde. Die Koproduktion der Länder Frankreich / Palästina / Schweiz / Katar lief auf der letzten 67. Berlinale in der Sektion Panorama Dokumente.
Es geht um ein Casting ehemaliger palästinensische Insassen des Moskobiya-Verhörzentrums in Jerusalem, die zudem Erfahrung als Handwerker, Architekten oder Schauspieler haben. Nach dem Casting, das fast wie ein Rollenspiel wirkt, lässt er in einer leeren Halle Verhörräume und Zellen der Gefangenen maßstabsgetreu nachbauen – immer in enger Abstimmung mit den Männern und basierend auf ihren Erinnerungen an den Ort. In dem realistisch anmutenden Setting spielen sie zusammen Verhörsituationen nach, diskutieren Details der Einrichtung und sprechen über die Erniedrigungen, die sie während der Haft erlebt haben. Mit Techniken, die an das sogenannte Theater der Unterdrückten erinnern, wird eine Re-Inszenierung von real Erlebtem erarbeitet. Die Rekonstruktion bringt lange unterdrückte Gefühle und unverarbeitete Traumata zum Vorschein, die Arbeit an dem Film laugt die Männer körperlich wie seelisch aus. Auch der Regisseur agiert vor der Kamera. Er schafft nicht nur eine Bühne für seine Protagonisten, er verarbeitet auch die eigenen bruchstückhaften Erinnerungen an seine Haft in Moskobiya vor über 30 Jahren. Hier der Trailer:
Filmkritik:
Vor über 30 Jahren wurde Raed Andoni im berüchtigten Gefängnis Moskobiya in Haft gehalten. Er war und ist einer von vielen. Ein Großteil der palästinensischen Bevölkerung, übrigens nicht nur Männer, ist bereits einmal in israelischer Haft gewesen und oder verhört worden. Ein Erlebnis, zumal wenn mit psychischer und oder psychologischer Gewalt gepaart, prägend wirkt. Raed Andoni (“Fix Me”) schaltete eine Anzeige in der Zeitung, in der er ehemalige palästinensische Inhaftierte in dem Jerusalemer Verhörzentrum sucht, um einen Film zu drehen. Bereits das Casting ist Teil der Dreharbeiten, beziehungsweise wird der Prozess des Castings den Hybridfilm einleiten.
Eine Gruppe Männer aus allen Altersgruppen und mit unterschiedlichem Background stellen sich zur Verfügung, um in einer Lagerhalle in Ramallah einen Film zu drehen. Ihre Erfahrung ist Teil ihrer Filmidentität. Der eigentliche Auswahlprozess, also ein Making of ist “Ghost Hunting” jedoch nicht. Die Prämisse ist, in einer Art Theaterinszenierung ein Trauma aufzuarbeiten und gleichzeitig dieses für Außenstehende erfahrbar zu machen. Der Film, der auf der Berlinale in der Sektion Panorama vorgestellt worden ist und den Dokumentarpreis des Sponsors Glashütte erhielt, ist nichts für schwache Gemüter. Auch ist ein emphatischer Ansatz vom Zuschauer von Nöten. Denn es gibt kaum Handlung, statt dessen verschieben sich die Erlebnisse, die sich bei den Männern ähneln, leicht hin und her. Die Erfahrung selbst, die kaum ein Zuschauer wirklich nachempfinden kann, ist flüchtig und schwer einfangbar.
Als die Besetzung steht, geht es daran, die leere Lagerhalle in ein Gefängnis umzugestalten, dessen genauen Grundriss keiner exakt kennt. Meist trugen die Männer in ihrer Gefangenschaft Augenbinden und einen Sack über dem Kopf. Doch mit der Arbeit am Set, sie bauen die Zellen nach und statten sie mit echten Türen aus, kommen auch die Erinnerungen zurück. Scheint es so, als würden wir nur dem Fortschritt des Aufbaus zuschauen, so muss man den Männern nur genau zuhören, die sich nach und nach öffnen und in ihren Unterhaltungen das Erlebte einfließen lassen und sich dann schließlich in die selbstgebauten Zellen einfinden, um das Erlebte in einem Rollenspiel nachzuzeichnen.
Das wirkt sehr künstlich, eben weil man zwar mit den Augen sieht, aber den Raum nicht mit dem Körper einnehmen kann. Es wirkt für den einen befremdlich, für den anderen eventuell zärtlich, wie die Männer ihr ehemaliges Gefängnis wieder aufbauen und in Besitz nehmen, und zwar nicht nur als Set sondern als lebendig bedrückenden Raum, der die finstere Atmosphäre über die Leinwand hinweg ausstrahlt, um längst Verdrängtes nach außen zu lassen, in dem Wissen, unter seines gleichen zu sein. Die Rolle der Israelis verblasst dabei, zumal der Regisseur keinen erklärenden Hintergrund gibt. Außer den Zahlen, die er in einer Tafel nennt, gibt er keinen geschichtlich politischen Unterbau vor. So steht, ganz wie ein Experiment, in dem sich die Menschen in Situationen der Macht und der Ohnmacht kaum widersetzen können, nur die Aufarbeitung und steht nur das Leben mit der Gewalt im Raum. Das kann so auch in ganz anderen Zeiten und Orten passieren und kann hier nur aus dem Grund nicht gänzlich ausgeklammert werden, weil der Konflikt, der die Männer exemplarisch wie eine Glocke umhüllt, noch nicht abgeschlossen ist. Letztendlich springt genau dieser Funke dann über auf das Publikum.
Elisabeth Nagy
+++++++++++++++
"Haus ohne Dach" (Deutschland / Irak [KRG] / Katar 2016, 119 Minuten) von der jungen Filmemacherin Soleen Yusef kam auf den zweiten Platz, wie uns erst letzte Woche von den Festivalmachern mitgeteilt wurde.
Auch diesen Film hatten wir samt Trailer zur Eröffnung des Festivals bereits vorgestellt. Es geht darin um die Geschwister Liya, Jan und Alan, die in Iraqi Kurdistan geboren wurden und in Deutschland aufgewachsen sind. Der Tod der Mutter bringt die drei nach langer Zeit getrennter Wege wieder zusammen. Es ist Ihr letzter Wunsch gewesen, neben dem im Krieg gefallenen Vater beerdigt zu werden. Gegen den resoluten Widerstand der Großfamilie brechen die drei ungleichen Geschwister auf eine abenteuerliche Odyssee durch Kurdistan auf. Dabei werden sie nicht nur mit einem ungeheuerlichen Familiengeheimnis konfrontiert, sondern auch mit ihren eigenen Dämonen. Je weiter sie kommen, wird die Reise zum Prüfstand nicht nur für die Geschwister selbst. Der Debütfilm der in Duhok geborenen Regisseurin wurde 2016 beim Montreal World Film Festival mit dem »Special Grand Prix of the jury« prämiert.
Filmkritik:
Am Anfang steht ein im Chaos arrangiertes Familienfoto. Vater, Mutter und die Kinder und da alles schief geht, schneiden die Kinder ausgelassen Grimassen. Die Handlung von “Haus ohne Dach” setzt Jahre später ein, als die Geschwister Jan (Sasun Sayan), Alan (Murat Seven) und Liya (Mina Sadic) bereits erwachsen sind. Sie sind nach der Flucht vor dem Regim Saddam Husseins aus dem kurdischen Teil des Irak in Deutschland heimisch geworden und zwischen zwei Kulturen aufgewachsen. Umso härter trifft es sie, als ihre Mutter, Gule (Wedad Sabri), zurück in die Heimat ziehen möchte. Nur eines ihrer drei Kinder begleitet sie, während die anderen zwei ihre wacklige Existenz in Deutschland nicht aufgeben wollen. Erst als die Mutter stirbt, kommen sie wieder zusammen, wenn auch nicht aus freien Stücken. Die Mutter verfügte, dass die untereinander entfremdeten Geschwister sie nach ihrem Tod gemeinsam neben ihrem Vater, der im Krieg starb, beerdigen mögen.
“Haus ohne Dach” ist ein Roadmovie. Nicht nur das Grab des Vaters muss gefunden werden, die drei Kinder der Nachfolgegeneration müssen ein Miteinander finden und eine Haltung gegenüber dem Heimatland, der Familie und ihrer Identität. Dabei ist bereits der Anfang schwer, denn die Familie der Mutter lehnt den verstorbenen Vater grundsätzlich ab, aus Gründen, die sich nicht allen drei erschließen und auch den Zuschauern erst spät enthüllt wird. Eine Beerdigung neben dem Vater ist aus Sicht des Familienclans ausgeschlossen. Kurzerhand entführen die Geschwister den Sarg und fahren los. Eine ganze Kette an Ereignissen setzt sich in Gang. Die Familie folgt den Ausreißern, Grenzen müssen überwunden werden und mit jedem Checkpoint wird die Mission undurchführbarer. Ein Roadmovie also, ein Abenteuerfilm, durchaus mit Anlangen zu komischen Situationen. Die Regisseurin Soleen Yusef vermittelt die Handlung auf eine geradlinige Weise, gibt den Figuren, also auch den Nebenfiguren, allerlei Sympathien mit, wüsste man nicht um die reale Ebene, könnte es eine Komödie sein.
Soleen Yusef wollte “Haus ohne Dach” in ihrer Heimat drehen. Auch sie, Jahrgang 1987, musste als Kind flüchten und wuchs in Deutschland auf.
Nach einer Gesangs- und Schauspielausbildung fing sie 2008 ein Regie-Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg an. “Haus ohne Dach” ist ihr Abschlussfilm und gewann letztes Jahr unter anderem den First Step Award und den Friedenfilmpreis des unabhängigen Filmfests Osnabrück. Dabei ist die Entstehen des Dramas sicherlich auch eine Geschichte wert.
Nach ihrem Kurzfilm “Trattoria” (2012, Perspektive Deutscher Film) wollte Soleen Yusef nicht nur einen - wie sie es nennt - “kurdischen Heimatfilm” drehen, sie wollte mit ihren eigenen Erfahrungen dem Publikum einen persönlichen Einblick in die Psyche der Flüchtlinge geben. Doch während sie die Dreharbeiten in der kurdischen Region im Nordirak vorbereitete, überfiel der Islamische Staat die Stadt Mossul, die nur 60 Kilometer von Dohuk, ihrer Heimatstadt, entfernt liegt. Ein Drehen war unmöglich geworden, neue Flüchtlingsströme setzten sich in Gang. Soleen Yusef schrieb das Drehbuch um, bettete die ursprüngliche Handlung in diese neue Realität ein, gab ihr eine weitere Ebene, eine Dringlichkeit, ohne die eigentliche Aussage aus dem Fokus zu rücken. Die Geschwister erleben während ihrer Odyssee diesen Stimmungswechsel in der Region, deren Entladung sie mittelbar miterleben. Die Geschwister, die so mühselig ihre Wurzeln und ihre Geschichte suchten, die neue Freunde und Bekanntschaften machten, müssen aus der Ferne mit ansehen, wie ihre Heimat auseinander fällt. Der Gefühle von Trauer und Bedauern mit einer Region, von deren Schönheit und von deren Bewohnern man sich gerade ein Bild machen konnte, kann man sich gar nicht verschließen.
Elisabeth Nagy
+++++++++++++++
An dritter Stelle in der Beliebtheitsskala lag die Dokumentation "Bezness as Usual" von dem niederländischen Filmemacher Alex Pitstra, der bei den Nachforschungen zu seinen Wurzeln, mehr über sich und seine Familie in Tunesien erfährt, als er möchte. Hier der Trailer und eine Filmrezension von unserer Filmkritikerin, die ganz begeistert war:
Filmkritik:
Bilder einer Kindheit ziehen an uns vorbei. Wir sehen Homevideo-Aufnahmen zu denen der holländische Regisseur Alex Pitstra aus dem Off erzählt. Sein Vater habe ihm das Radfahren beigebracht. Aber zu seinem fünften Geburtstag kam er nicht, dabei hatte er es versprochen. Er kam überhaupt nicht mehr. Erst viel später erfuhr er, dass sein Vater verhaftet und abgeschoben worden war. Dem Kind sah man sein väterliches Erbe nicht an. Erst als er älter wurde, wurden die Reaktionen auf seine Herkunft offensichtlich.
Alex Pitstra wuchs ohne Vater auf. Er wollte seiner Mutter auch nicht weh tun und so blieb der Vater ein Tabu. Erst als er 25 Jahre alt war, erreichte ihm ein Brief des Vaters, der seine Adresse nicht gekannt hatte. Mohsen Ben Hassen lebte inzwischen wieder in Tunesien und hatte eine Familie. Der Vater wollte ihn kennenlernen und er wollte seinen Vater kennenlernen. Pitstra, der bereits als Jugendlicher mit dem Filmen anfing, nahm die Kamera und war aufgeregt. Er flog nach Tunesien und lernte einen freundlichen Mann kennen. Der Vater bat ihn, mit seiner Halbschwester, die in der Schweiz lebt, Kontakt aufzunehmen und auch sie dazu zu bewegen, in die väterliche Heimat zu kommen.
Alex Pitstra setzt dramaturgisch an einer anderen Stelle ein. Er zeigt uns Homevideos aus den 70ern. Touristen bevölkerten die tunesischen Strände und junge Männer zeigten den Touristinnen ihr Land. So lernte Mohsen Anneke kennen, sie heirateten, lebten in Amsterdam, bekamen einen Sohn. Doch es gab kein Happy End. Nach und nach schält Pitstra heraus, mit welchen Erwartungen damals Beziehungen geknüpft worden sind und welche Auswirkungen das hatte. Die Kamera ist das Brennglas, die ihm, dem Filmemacher, der sich doch auf der Suche nach seinen Wurzeln wähnte, als Mittel zur Verständigung und des Verstehens dienen sollte. Aber wer weiß, vielleicht verstellt ihm der Ansatz, seine Suche filmisch zu begleiten, auch seine Sicht. Alex Pitstra ist selbstkritisch genug und gesteht ein, dass die Erkenntnisse, die scheinbar so offensichtlich vor ihm liegen, sich ihm nicht so schnell erschlossen.
2005 kam er das erste Mal nach Tunesien, um seinen Vater und die Großfamilie zu besuchen. Seitdem reiste er immer wieder hin und zurück. Aus “Bezness as Usual”, seinem Langspielfilmdebüt (das trotzdem für das Fernsehen nur in einer Kurzfassung von 52 Minuten zu sehen sein wird) wurde eine Langzeitdokumentation, die die Einschätzung und Betrachtung der Beteiligten immer feiner herausschält und dem Publikum immer neue und präzisere Einsichten beschert. Die Beteiligten werden dabei so komplex dargeboten, dass Offensichtliches trotzdem erst mit seinem eigenen Erkenntnisgewinn eingebracht wird. Ernüchterung, Frustrationen und Enttäuschungen inklusive.
Ganz anders ging seine Halbschwester Jasmin an das Wiedersehen heran. Durch ihre Figur wird der Spurensuche Dankenswerterweise eine Ebene hinzugefügt, die es ohne sie gar nicht geben könnte, die jedoch elementar wichtig ist. In ihrer Kindheit war die Vaterfigur eine Bedrohung, hatte er doch gedroht, sie von ihrer Mutter aus der Schweiz zu entführen. Das sei eine Aussage, die er so leicht dahin gesagt haben will, doch sie bleibt misstrauisch. Sie spürt auch viel eher und viel nachhaltiger, wie der Vater auf seine Kinder reagiert. Sie kann sein Frauenbild auch weder akzeptieren noch kritiklos hinnehmen.
“Bezness as Usual” ist kein Flüchtlingsfilm, er dreht sich um Identität zwischen zwei Kulturen und in erster Linie um den Mensch zwischen Vater und Mutter. So ähnlich kann es auch zu anderen Zeiten und in anderen Kulturräumen ablaufen. Aber Pitstra, der recht eindeutig seine komplizierte Selbstidentifikation auf dem Plakat mit Aus- und Unterstreichungen heraushebt, muss sich der Tatsache stellen, dass die Beziehung zwischen seinem Vater und seiner Mutter auch eine Art Deal war, und er folglich eine Verlängerung dieses Deals darstellt. Die Träume, die sein Vater gehabt haben muss, haben mit den Träumen seines Sohnes oder seiner Tochter gar nichts zu tun. Auch das ist eine Einsicht, die sich zumindest der Sohn erarbeiten muss, während die Tochter viel entscheidender ihr eigenes Leben bestimmt. Das vermittelt Alex Pitstra ganz wertfrei und damit für die Zuschauer sehr lehrreich. So kann man auch das Zögern und vielleicht auch Scheitern des Regisseurs, konsequent Stellung zu beziehen, als Schritt auf dem Weg begreifen.
Elisabeth Nagy
Link: www.alfilm.de

Kommentare
Ansicht der Kommentare: Linear | Verschachtelt